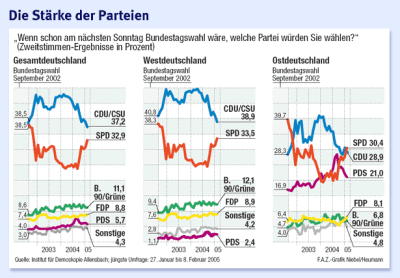Deutsche Fragen - deutsche Antworten
Die Schwäche einer verzagten Nation
Von Professor Dr. Renate Köcher
16. Februar 2005 Die Meldungen vom Arbeitsmarkt sind dazu angetan, eine Besserung der Stimmung in der Bevölkerung im Keim zu ersticken.
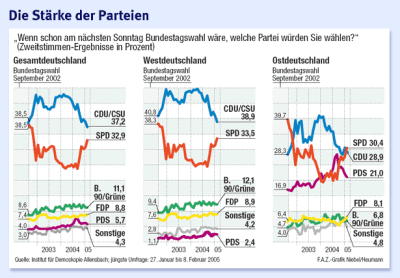
Zwischen November und Mitte Januar hatte sich der Anteil an der Bevölkerung, der die ökonomischen Aussichten für die kommenden Monate pessimistisch einschätzt, ständig zurückgebildet, von 46 auf 32 Prozent. Dieser Trend ist vorläufig gebrochen. Mittlerweile befürchten wieder 37 Prozent eine Abwärtsentwicklung; lediglich 18 Prozent hoffen auf einen dynamischen Aufschwung, 39 Prozent erwarten weitgehend stabile wirtschaftliche Daten.
Keine Illusionen
In bezug auf die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes gibt sich die Bevölkerung keinen Illusionen hin. Nur wenige rechnen mit raschen Erfolgen, die Mehrheit nimmt an, daß die Arbeitslosigkeit auch mittel- und langfristig weiter steigt. Die Bevölkerung beobachtet in ihrer Umgebung etwa anhand der spektakulären, in den Medien berichteten Fälle, wie die Unternehmen an ihren Kosten arbeiten, Personal abbauen und Unternehmensteile an kostengünstigere Standorte verlagern.
66 Prozent der Leute ist bewußt, daß viele Unternehmen Teile ihrer Produktion, zunehmend auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verlagern; die Mehrheit rechnet damit, daß dieser Trend in den nächsten zehn Jahren an Dynamik gewinnen wird. Nur 9 Prozent der Bevölkerung erwarten, daß sich die Unternehmensmigration verlangsamt. 48 Prozent der gesamten Bevölkerung halten Deutschland als Wirtschaftsstandort mittlerweile für ernsthaft gefährdet; nur noch 31 Prozent verfolgen die seit Jahren andauernde Standortdebatte mit der optimistischen Einschätzung, daß das Thema überbewertet, die Gefahren übertrieben würden.
Hohe Belastungen
Die Bevölkerung erkennt eine größere Zahl von Belastungsfaktoren, welche die wirtschaftliche Entwicklung hemmen und Deutschlands Zukunftschancen beeinträchtigen: vor allem die wuchernde Bürokratie und Regelungswut, die Steuer- und Abgabenlast, ein unzureichend qualifiziertes Management in einem Teil der Unternehmen, hohe Energiepreise, zu lange Genehmigungsverfahren, die Fehlsteuerungen durch staatliche Subventionen, Mängel im deutschen Bildungssystem, die hohe Staatsverschuldung.
83 Prozent machen die Perfektionierung bürokratischer Verfahren verantwortlich, 77 Prozent die Höhe der Steuern und Abgaben, 61 Prozent die hohen Energiepreise, 53 Prozent Subventionen für nicht wettbewerbsfähige Branchen. Dagegen nehmen nur 24 Prozent an, daß die wirtschaftlichen Zukunftschancen Deutschlands vor allem durch die Globalisierung beeinträchtigt werden (Tabelle).
Die Politik muß steuern
Als Belastungen identifiziert die Bevölkerung damit in erster Linie Parameter, die unmittelbar durch die nationale Politik steuerbar sind. Dies ist ein Mißtrauensvotum gegenüber der Politik, zugleich jedoch der Nährboden für Optimismus: Die Bevölkerung ist überzeugt, daß Korrekturen an den richtigen Stellen den Standort nachhaltig stärken würden. 59 Prozent der Bevölkerung glauben daran, daß die Abwanderung von Unternehmen gebremst oder sogar umgekehrt werden kann.
Auch das Argument, daß Deutschland im Wettbewerb mit Niedriglohnländern auf verlorenem Posten steht, mit osteuropäischen oder gar chinesischen Löhnen nicht konkurrieren kann, macht die Mehrheit der Leute nicht in ihrer Überzeugung irre, daß der Standort Deutschland durch politische Maßnahmen erfolgreich gestärkt werden könnte.
Schwaches Selbstvertrauen
Trotzdem ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Handlungsmöglichkeiten zu gering, der Anteil derer zu groß, der die Zukunft fatalistisch ausschließlich von den machtvollen weltweiten Entwicklungen abhängig sieht und daher ein Ausgeliefertsein fühlt. 38 Prozent der Bevölkerung werden von diesem Empfinden bestimmt; 44 Prozent sind demgegenüber der Auffassung, daß die Zukunft vor allem davon abhängt, wie das Land auf die internationalen Entwicklungen reagiert, wieweit es alle Kräfte einsetzt, um die eigenen Stärken zur Geltung zu bringen und die Chancen zu nutzen.
Nur eine Minderheit nimmt jedoch an, daß dieser Weg konsequent verfolgt wird. Das Selbstvertrauen, die Herausforderungen erfolgreich bestehen zu können, ist nur schwach entwickelt. Lediglich 29 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, daß Deutschland seine Schwierigkeiten in absehbarer Zeit in den Griff bekommen wird. Der Optimismus, daß mit den richtigen Maßnahmen durchaus nachhaltige Erfolge erzielt werden könnten, wird von der tiefsitzenden Skepsis überlagert, ob dieser Befreiungsschlag tatsächlich erfolgen wird.
Alle erwarten eine Verschlechterung
Deutschland wird von der Einschätzung gelähmt, daß es seine beste Zeit hinter sich hat und von der Zukunft nur eine Verschlechterung des Status quo erwarten kann. Die Mehrheit rechnet mit der sukzessiven Senkung des erreichten Wohlstandsniveaus, richtet sich auf härtere Zeiten und wachsende Risiken ein. Eine Gesellschaft, die fürchtet, mehr verlieren als gewinnen zu können, tendiert fast zwangsläufig dazu, eher in Kategorien der Schadensbegrenzung zu denken als ihre Chancen zu suchen.
Diese Denkweise prägt die Reformdiskussionen ebenso wie die Analyse der Position Deutschlands im internationalen Wettbewerb. Auch wenn nur eine Minderheit die Globalisierung als einen der bedeutendsten Belastungsfaktoren für die Entwicklung des Landes sieht, überwiegt die Einschätzung, daß die globalen wirtschaftlichen Tendenzen für Deutschland mehr Risiken mit sich bringen als Chancen.
Ein Land mit den Voraussetzungen der Bundesrepublik kann weder in einer personalaufwendigen Fertigung noch in einfachen standardisierten Massenproduktionen seine Zukunft suchen. Seine Chancen liegen in Produkten, die eine hervorragende Infrastruktur und gut ausgebildete Arbeitskräfte voraussetzen, in Forschungsleistungen und Innovationen, in zuverlässig hoher Qualität und in komplexen Produkten und Problemlösungen.
Autos, Umwelt- und Medizintechnik
Die Bevölkerung hat durchaus eine klare Vorstellung davon, was Deutschland aufgrund seiner Voraussetzungen, Erfahrungen und seiner Mentalität besonders gut kann: Autos bauen, die in der ganzen Welt begehrt sind, Industrieanlagen fertigen, Technologien und Verfahren entwickeln, die Umweltschutz voranbringen, wissenschaftlich forschen, besonders die medizinische Forschung vorantreiben, sowie Schiffe, Flugzeuge und sichere Reaktoren bauen.
Die Einschätzungen, in welchen Branchen für die Zukunft Deutschlands die größten Chancen liegen, sind jedoch nur eingeschränkt an den Vorstellungen von eigenen Stärken ausgerichtet. An der Spitze der Branchen, denen das größte Potential, die größte Bedeutung für die künftige Entwicklung des Landes zugeschrieben wird, stehen nahezu gleichauf die Autoindustrie und die Hersteller von Windkraftanlagen und Solarzellen; 51 Prozent der Bevölkerung rechnen die Autoindustrie, 50 Prozent die Produzenten von Anlagen für die Nutzung regenerativer Energien zu den erfolgsträchtigsten Zukunftsbranchen - vor der Pharmaindustrie (44 Prozent), der Chemischen Industrie (40 Prozent), Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Maschinenbauindustrie, die von jeweils gut einem Drittel genannt werden.
Wenig Hoffnung in Kerntechnik
Das Ausmaß der Hoffnungen, die die Bevölkerung auf die Hersteller von Windkraftanlagen und Solarzellen richtet, ist mehr ein Indiz für die Wirksamkeit politischer Programmatik und Suggestion als für klare Vorstellungen von der Bedeutung von Branchen. Mit politischen Vorgaben hat auch zu tun, daß nur 12 Prozent die Kerntechnologie zu den Sparten rechnen, die für Deutschlands Zukunft große Chancen bieten - ein Gebiet, auf dem Deutschland über Jahrzehnte Weltruf genoß.
Auch der Gentechnologie schreibt nur eine Minderheit großes Potential zu: Zwar rechnen 44 Prozent die Pharmaindustrie zu den für die Zukunft entscheidenden Branchen, aber nur 22 Prozent messen den speziell mit gentechnologischen Verfahren befaßten Unternehmen dieselbe Bedeutung zu. Unter dem Eindruck des Kurses der Bundesregierung hat sich in den letzten Jahren bei den Bürgern kontinuierlich die Überzeugung verstärkt, daß Deutschland kein geeigneter Standort für Unternehmen ist, die auf diesem Gebiet forschen und arbeiten.
„Deutschland überläßt die Forschung anderen”
Vor vier Jahren waren noch 31 Prozent überzeugt, daß dieses Land für Unternehmen der Gentechnologie ein guter Standort ist, heute sind es noch 18 Prozent; umgekehrt hat sich der Anteil, der die Bundesrepublik hier für einen schlechten Standort hält, von 31 auf 43 Prozent erhöht. 57 Prozent stimmen der Kritik zu, daß Deutschland zunehmend abhängig wird, da es die Forschung und Entwicklung neuer Verfahren und Produkte auf wichtigen Feldern anderen Ländern überläßt.
Bemerkenswert ist jedoch der Gleichmut, mit dem viele die Abwanderung zukunftsträchtiger Forschungsaktivitäten verfolgen. So halten 43 Prozent Deutschland für einen schlechten Standort für die Erforschung, Entwicklung und den Einsatz gentechnischer Verfahren; nur 17 Prozent halten dies jedoch für nachteilig und beunruhigend.
Weniger emotionale Kritik an Gentechnik
Das ist nicht mit Ängsten und Vorbehalten gegenüber einem Forschungsfeld zu erklären, das in die öffentliche Diskussion vor vielen Jahren mit apokalyptischen Visionen einer mißbräuchlichen Anwendung eingeführt wurde. Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt heute eine positive oder neutrale Position zum Einsatz gentechnischer Verfahren ein. Insbesondere auf medizinischem Gebiet verbindet die überwältigende Mehrheit mit der Gentechnologie große Hoffnungen.
Ein Emotionstest zeigt, daß sich das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren erheblich verändert hat. Wenn eine Expertendiskussion über die Einsatzmöglichkeiten der Gentechnologie simuliert und von einem Zwischenrufer aus dem Publikum mit dem Protest unterbrochen wird: "Was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang. Wie kann man überhaupt so kalt über ein Thema reden, bei dem es um künstliche Eingriffe in die Natur geht!", so sympathisieren heute noch 39 Prozent der Bevölkerung mit dem Zwischenrufer.
Auch die Zahl der Kernkraftgegner nimmt ab
Mitte der neunziger Jahre konnte sich der emotionale Protest gegen diese Forschungsrichtung noch der Unterstützung der Mehrheit, nämlich von 51 Prozent der Bevölkerung, sicher sein.Auch die Kernenergie wird heute wesentlich nüchterner beurteilt als in den achtziger oder noch Anfang der neunziger Jahre. Der Ausstiegsbeschluß der rot-grünen Koalition war eine politische Entscheidung, die nicht auf den Druck der Mehrheit der Bevölkerung zurückging.
Die Zahl der engagierten Kernkraftgegner, die auf einen möglichst raschen Ausstieg dringen, hat stetig abgenommen und beträgt heute weniger als ein Fünftel der Bevölkerung. Das Problem ist jetzt nicht mehr, daß Deutschland Weltanschauungskriege führt, wo andere Länder kühl Chancen und Risiken prüfen. Das Problem ist eine mangelnde Auslotung und Nutzung von Chancen in Verbindung mit einer mentalen Schwäche, die verhindert, daß die Zukunft selbstbewußt als vielversprechende Herausforderung angenommen wird.
Bildmaterial: F.A.Z.